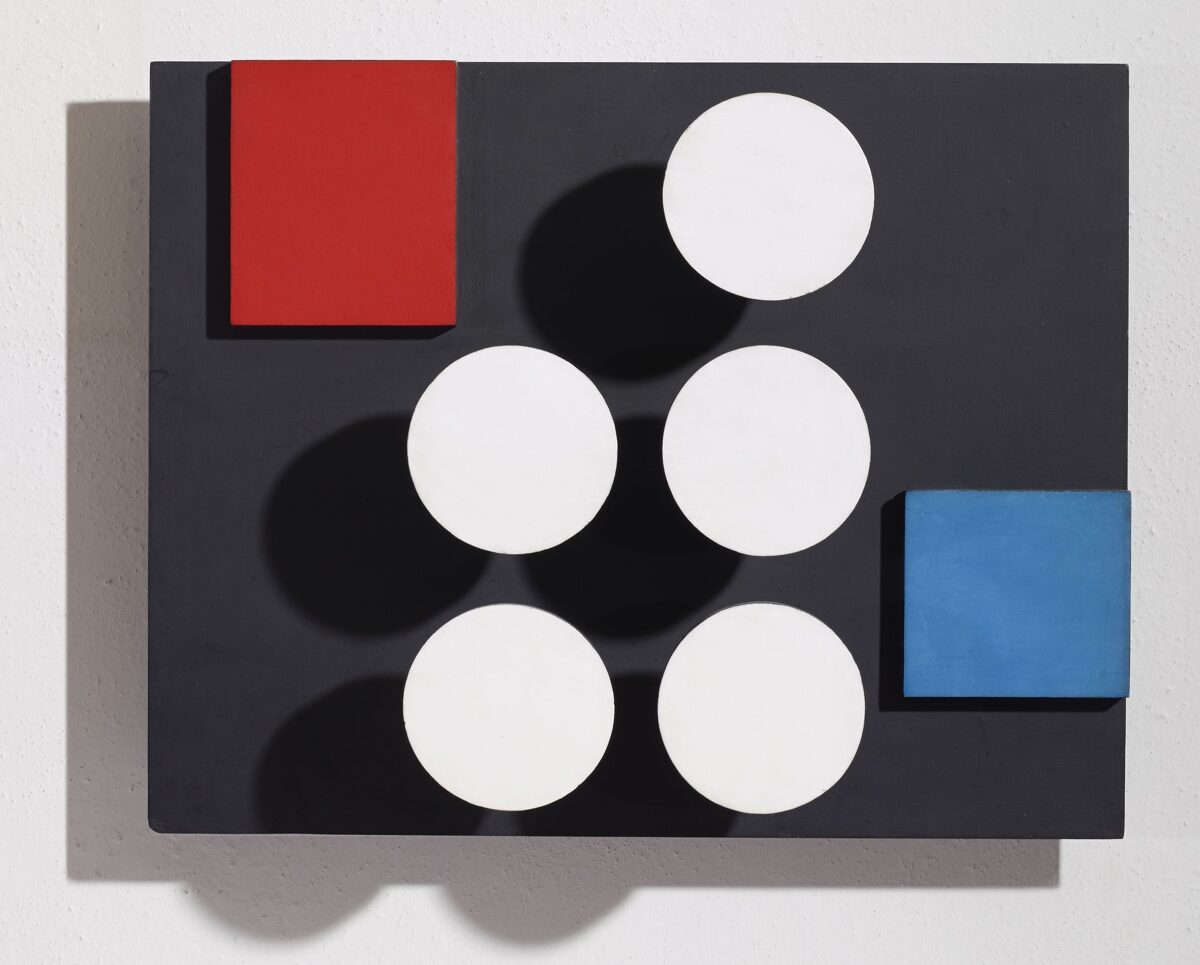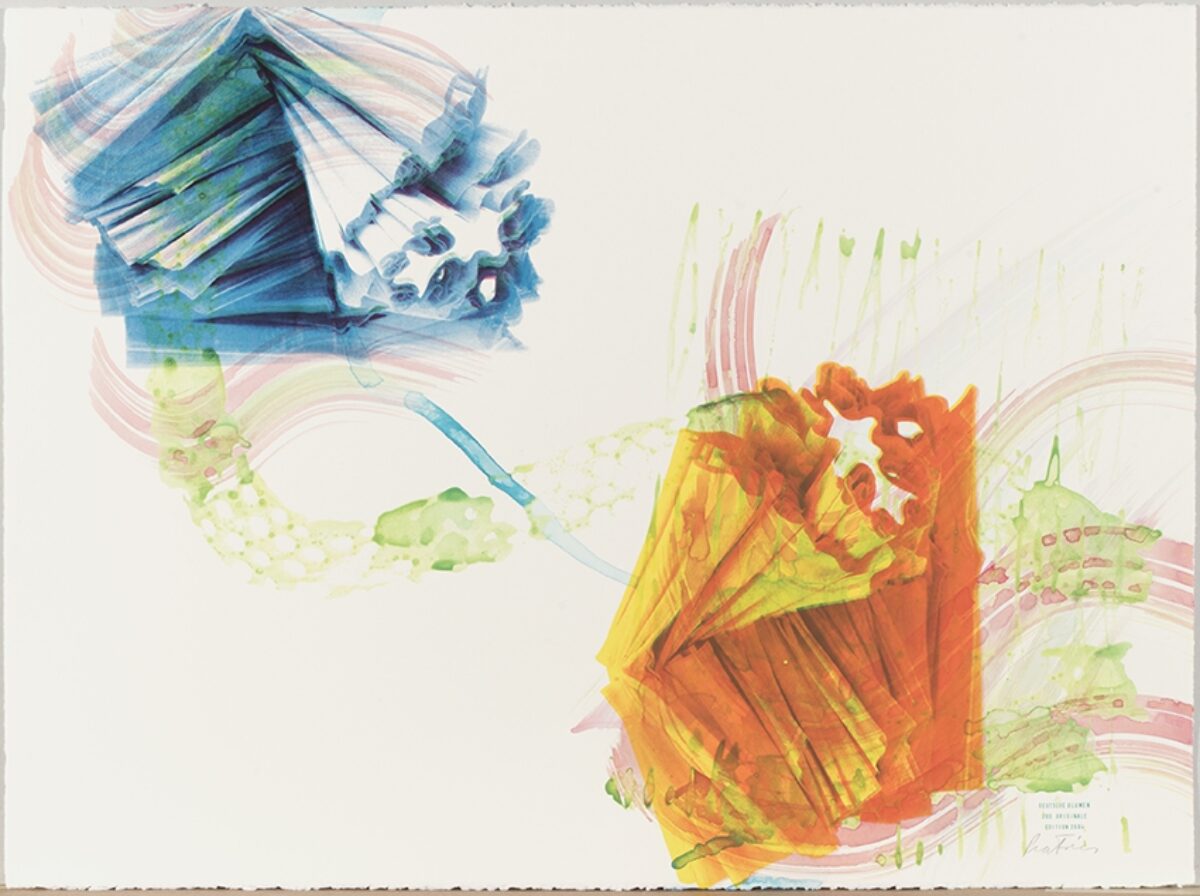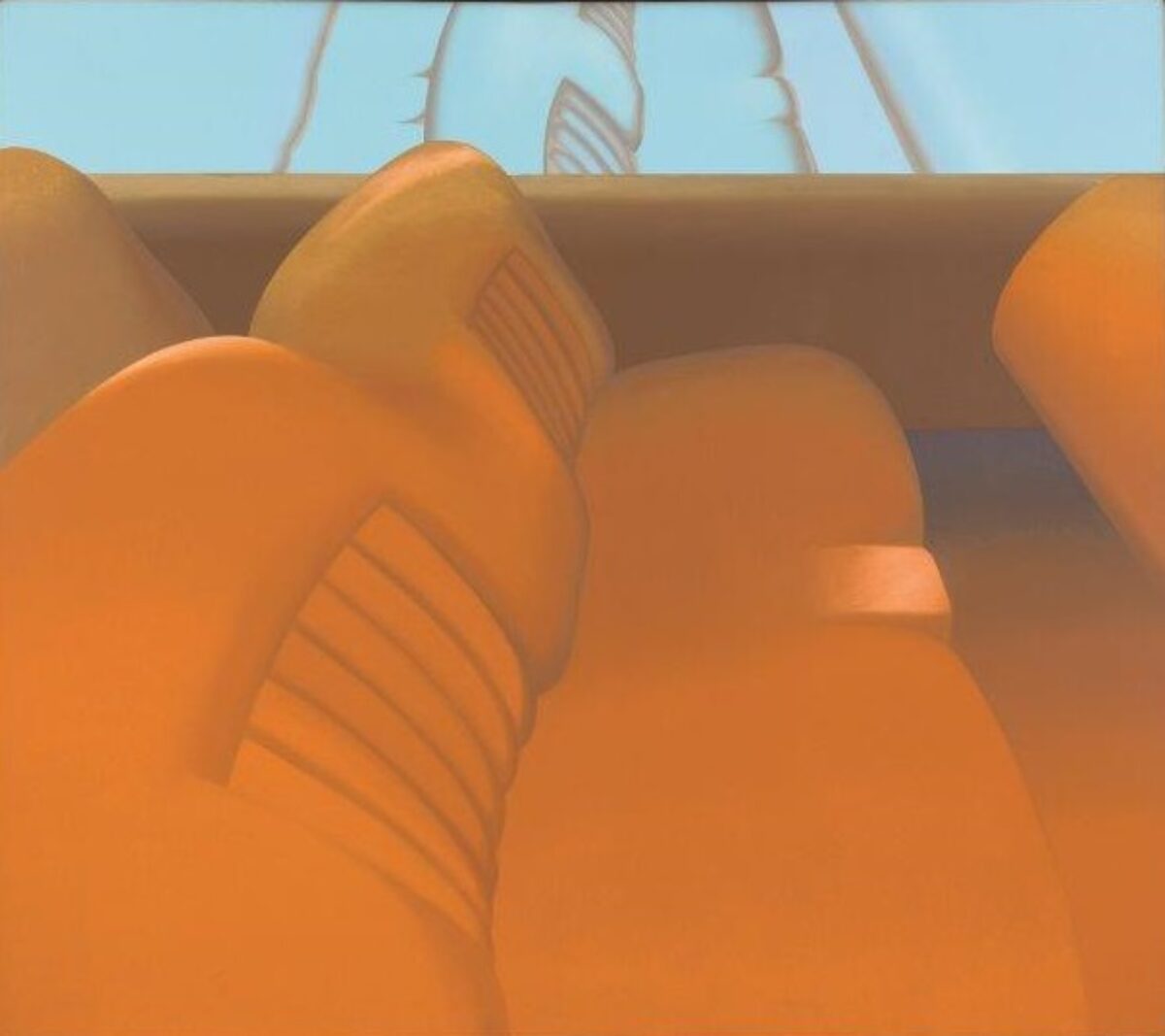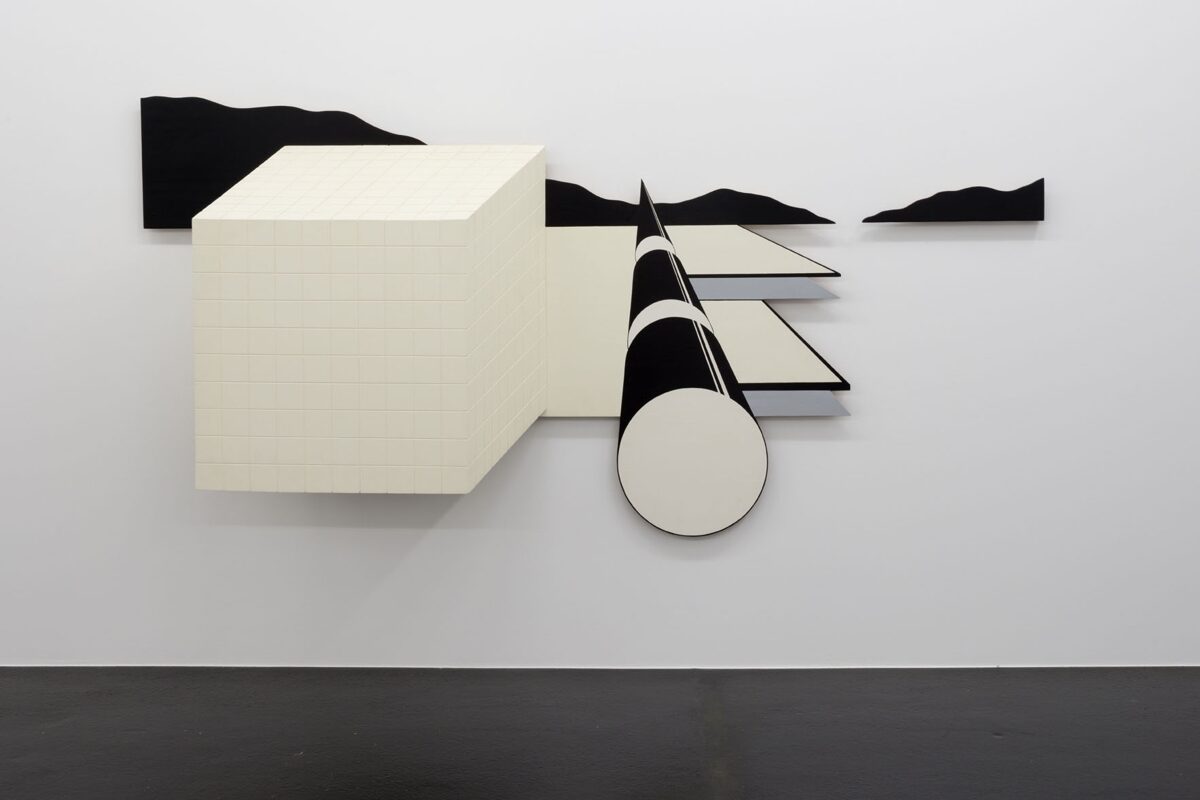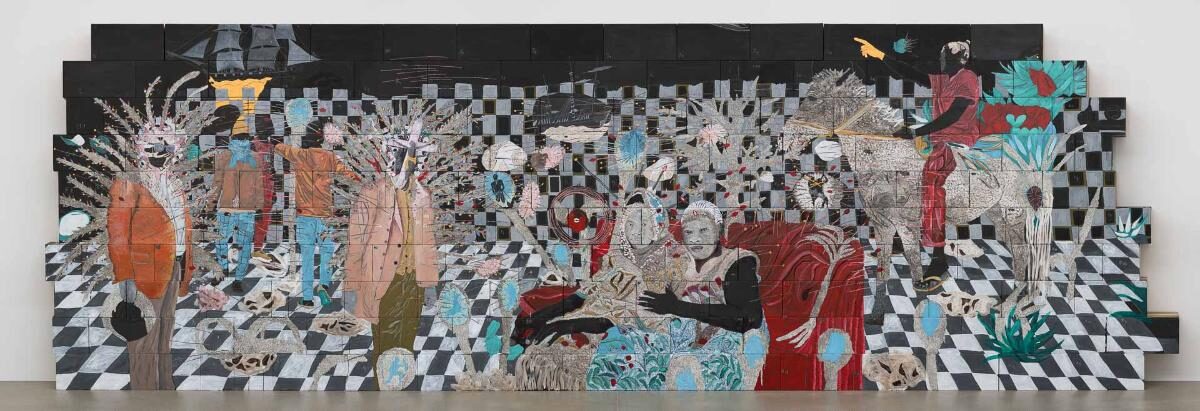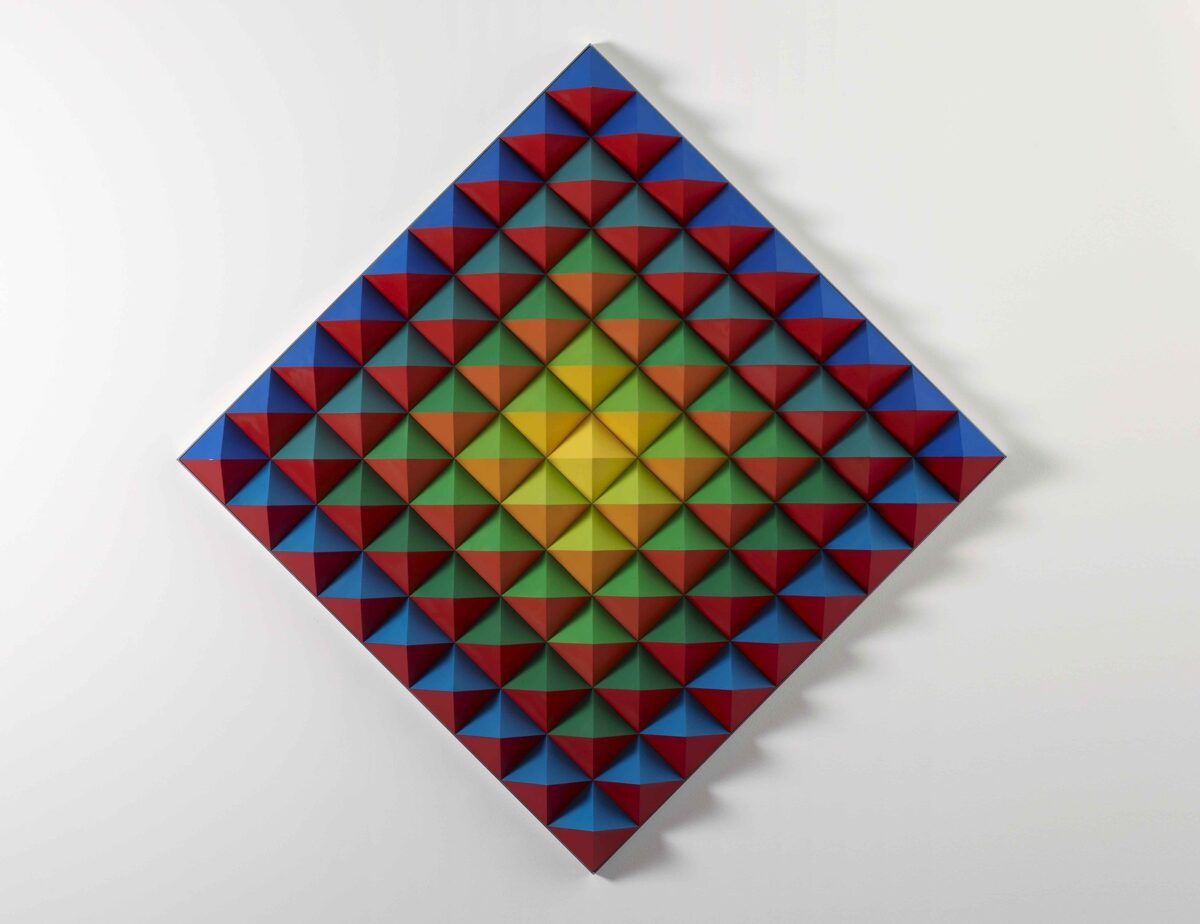Aquarell und Tusche auf Papier, 41.1 x 50.3 cm
Der in Bern geborene Fritz Pauli (1891–1961) zählt zu den repräsentativen Schweizer Künstlern seiner Generation. Sein Talent wird früh erkannt. Nach einer Lehre zum Dekorationsmaler wird er vom Schweizer Maler und Radierer Albert Welti (1862–1912) gefördert und absolviert ein Studium in München. Nach Ausbruch des zweiten Weltkriegs kehrt er in die Schweiz zurück, wo er sich grafisch vielfältig mit den existenziellen Ängsten seiner Zeit auseinandersetzt. Es entstehen eindrückliche Figurenbildnisse. Ab 1917 befreit er sein Werk von literarischen Details und stösst zu einer einfacheren, doch zugleich leidenschaftlich intensiven Darstellungsweise vor.
Gerne wird Fritz Pauli in einem Atemzug mit den Malern Ignaz Epper (1892–1969), Otto Müller (1874–1930) und Robert Schürch (1895–1941) genannt. Diese sind nicht nur freundschaftlich miteinander verbunden, sondern auch durch ihre Beschäftigung mit dem in den 1920er-Jahren aufkommenden Expressionismus. Anders als Schweizer Künstler, die sich der Künstlergruppe Rot-Blau anschliessen, halten diese bewusst Distanz zu den deutschen Hauptvertretern des Expressionismus. Edvard Munch (1863–1944) und Ernst Ludwig Kirchner (1880–1938) dienen Fritz Pauli zwar als wichtige Inspirationsquellen, doch verfällt er zu keinem Zeitpunkt der Nachahmung. Stattdessen bildet er seine ganz eigene Bildsprache aus. Ernst Ludwig Kirchner selbst schreibt 1925 in einem Brief an den Kunstkritiker und späteren Direktor des Kunstmuseums Basels: „Kennen Sie den Graphiker Pauli? (…) Seine Begabung ist sehr phantastisch mystisch (…) Psychisch sehr fein empfundene Dinge mit einer starken fast mittelalterlichen Schwere der Form. Auch er wird eine starke Stütze der modernen Bestrebungen in der Schweiz werden.“
Die beiden lernen sich 1925 in Davos kennen. Pauli verbringt mit seiner Frau die Sommermonate beim Ehepaar Kirchner in „Wildboden-Frauenkirch“. In diesem Kontext entsteht auch das Aquarell „Frauenkirch Davos“ (1925). Die kleinformatige Papierarbeit zeigt eine dynamisch angelegte Berglandschaft. Gestisch bewegte Tuschelinien überlagern und kreuzen sich mit düster leuchtenden, sich drapierend aneinanderschmiegenden Farbflächen. Dem zackigen Hochgebirgszug lagern sich geschwungene Berge vor – gefolgt von einem dicht bewaldeten Tal, dessen Steilhang zu uns Betrachtenden hinaufführt. Eine kleine Holzhütte, vielleicht ein Stall, fügt sich in die unwegsame Hügellandschaft ein. Unten im Tal lässt sich eine winzige Häusergruppe ausmachen – womöglich ein Bauernhof. Dunkle Wolken am Himmel deuten auf ein kommendes Gewitter hin.
In den 1920er- und 30er-Jahren unternimmt Pauli zahlreiche Wanderungen und Reisen – hält sich am Zugersee auf, in Arosa, Davos, Amden, reist ins südfranzösische Collioure, nach Montreux, Marseille, Tunis und Paris. Erst 1935 lässt er sich im Tessiner Cavigliano nieder. Die 1930er-Jahre erweisen sich als äusserst fruchtbare Zeit, in der vor allem Radierungen, Zeichnungen und Aquarelle entstehen. Dazu gesellt sich ab 1928 ein gesteigertes Interesse an der Malerei. Bei seinen Aufenthalten in Fex (1918) und Arosa (1923) werden die Bündner Berge ein wichtiges Thema in Paulis Bildern. In Davos vertieft er diese: neben verschiedenen Graphiken malt Pauli zudem um 1925 seine ersten Landschaftsgemälde „Bergbauern“ und die „Mondnacht bei Frauenkirch-Davos“. Letzteres befindet sich in der Sammlung des Aargauer Kunsthauses. Während das eine durch seine Darstellung der Feldarbeit die Härte der bergbäuerlichen Existenz sichtbar macht, zelebriert das andere – ähnlich wie in der Papierarbeit „Frauenkirch/Davos“ – die archaische, nahezu unberührte Natur. Paulis Bilder erinnern an ein gewaltiges Welttheater, indem Lichtungen und Täler wie Bühnen sind für einsame Wanderer, Arbeitende oder die blosse Absenz des Menschen. Das Gefühl menschlichen Verloren-Seins angesichts der übermächtigen, spannungsgeladenen Natur haftet den meisten dieser Darstellungen an. Paulis Bilder sind keine geschauten, topografisch korrekten Landschaften, sondern erlebte und gebaute Seelenlandschaften – ringend zwischen Licht und Schatten. Mal Ausdruck des Unbewältigten, mal Sinnbild für die Grösse der Schöpfung.
Julia Schallberger, 2023